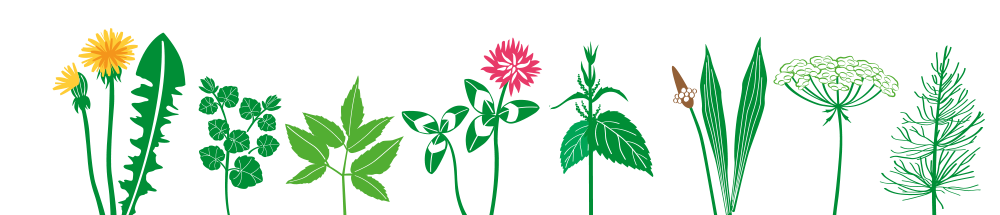Taraxacum
officinale
Merkmale
Der Löwenzahn ist eine sehr formenreiche Art. Die Blätter sind meist tief eingeschnitten bzw. sägeförmig eingekerbt. Als Rosette am Boden zeigen sich die Blätter schon im zeitigen Frühjahr. Blüten in einem großen, einzelnen Körbchen, nur Zungenblüten. Die Stengel sind blattlos, weitröhrig mit weißem Milchsaft, der auf der Haut braune Flecken gibt. Nach der Blüte bildet sich die Pusteblume!
Der Löwenzahn ist nicht giftig!

Vorkommen
Vom Flachland bis ins Hochgebirge wächst er überall: Rasenplätze, Fettwiesen, Wegränder, Weiden, Felder, Schutthalden, Felder, lichte Wälder. Der Löwenzahn liebt den Stickstoff und fehlt deshalb an kaum einem Standort.
Verwendbare Teile
Im Frühjahr vor der Blüte die ganze Pflanze mit der Wurzel. Ab der Blüte bis Frühsommer sind die jungen Blätter und die Blüten verwendbar.
Geschichte
Geschichte
Weit verbreitet
... und doch unentdeckt
Wenig erstaunlich, dass der Löwenzahn schon in der Antike bekannt gewesen sein muss, was vielleicht an seiner starken Verbreitung lag. Dennoch wurde dieser auffälligen gelben Pflanze recht wenig Bedeutung beigemessen. Selbst die große abendländische Mystikerin Hildegard von Bingen erwähnt den Löwenzahn nicht.
Ob es vielleicht an der Selbstverständlichkeit des Vorkommens dieser "Allerweltspflanze" lag? Auch das Büchlein "Das geheime Wissen der Kräuterhexen" (dtv-Verlag) widmet sich dem Löwenzahl mit keiner Mythe, mit keinem volkskundlichen Wirkungshinweis.
Erst 1577 gedenkt Hieronymus Bock in seinem "Kräuterbuch" dem Löwenzahl, der Kuhblume oder Butterblume, wie unser Löwenzahn auch gerne genannt wird.
Vielleicht war das der Beginn einer besonderen Freundschaft des Menschen zum Löwenzahn?

Von Zwergen, Elfen und Gnomen
Einst, als Zwerge im Gebirge auf eine geheimnisvolle Art und Weise nach Gold gruben!
Das geschmolzene Gold füllten sie in kleine Schälchen und stellten diese auf eine Wiese, Elfen kamen und streuten Sonnenstaub darüber, so dass das Gold einen ganz besonderen Glanz erhielt. Natürlich brachte das Neider auf den Plan! Die Gnome kamen eines nachts und klauten das ganze Gold aus den Schüsseln. Doch die Zwerge ließen sich das natürlich nicht gefallen. Sie schlichen zu den inzwischen vor lauter Goldrausch besoffenen Gnomen und zogen ihnen eine tüchtige Tracht Prügel über.
Doch so ein Raub konnte immer wieder geschehen und so waren die Zwerge erfinderisch. Sie erfanden Schalen auf Stielen, die sich bei Sonnenuntergang schlossen. Damit war nachts das Gold nicht zu sehen, konnte aber tagsüber von dem Sonnenstaub der Elfen etwas abbekommen. Rings um die Stiele der Schalen bauten sie noch gefährliche Fallen, mit großen scharfkantigen Zähnen, die unerbittliche zuschnappen konnten.
Ja, die Gnome kamen wieder und sie konnten des nachts kein Gold sehen. Statt dessen schnappten die Fallen wie scharfe Zähne die Gnome auf. Darauf hin wurden die Gnome nie wieder gesehen.
Die Zwerge machten noch ein paar Jahre weiter. Dann war auch das Golderz zu Ende. Sie ließen die Schalen zurück und taten sogar in jede noch etwas Gold hinein und durch den Zauber der Elfen wurden daraus Blumen. Erst als die Menschen die Blumen entdeckten, gaben sie ihnen den Namen Löwenzahn.
Übrigens: die Vorrichtung funktioniert bis auf den heutigen Tag! Wenn die Sonne scheint, sind die Blütenschalen mit dem Gold weit geöffnet. Wenn die Sonne verschwindet, schließen sich die Schalen und kein Gold ist mehr zu sehen.
Vielleicht hat erst durch das Weitererzählen dieser Geschichte der Löwenzahn seinen Siegeszug durch alle Lande und in die Kräuterkunde angetreten.
Wirkstoffe, Verwendung und mehr...
Heilkräftige Wirkstoffe

Unter anderem finden sich in der Löwenzahnpflanze Bitterstoffe, Flavonoide, ein hoher Kaliumgehalt, in der Wurzel Fructose und Inulin. Die ganze Pflanze vor der Blüte und mit der Wurzel besitzt getrocknet und aufgekocht als Tee eine harntreibende Wirkung sowie Förderung der Gallensekretion. Ab der Blüte bis Frühsommer sind die jungen Blätter als Frühjahrskur anzuwenden.
Verwendung im Garten
Es klingt paradox: Ein Kultivieren des Löwenzahns im Haus- und Ziergarten ist wirklich nicht notwendig. Die Pflanze hat eh ihren Siegeszug durch alle Regionen schon lange hinter sich, so dass der Löwenzahn in keinem Garten fehlt. Besonders gedeiht Löwenzahn natürlich dort, wo üppigst Nährstoffe vorhanden sind, v.a. Stickstoff.

Ökologischer Wert
Vor allem für unsere Honigbienen ist der blühende Löwenzahn interessant, weil fette Löwenzahnwiesen eine schöne Bienenweide abgeben. In Nutzwiesen der Landwirtschaft sollte der Löwenzahn einen Anteil im Gesamtpflanzenbestand von 20 % nicht überschreiten. Für viele kleine Insekten ist die Blüte ein ideales Versteck und vorrübergehendes Zuhause. Haustiere, wie der Stallhase oder das Kaninchen haben den frischen, grünen Löwenzahn schon längst zu ihrem Lieblingsfutter erkoren. Kaum eine Pflanze sorgt so eifrig und umfangreich für eigene Nachkommen: Die Samen an den kleinen Fallschirmchen der Pusteblume lassen sich zu Millionen Kilometer weit tragen.
Verwendung in der Küche
So viele Löwenzahnpflanzen, so viele Möglichkeiten etwas Kulinarisches oder etwas Gesundes daraus zu zaubern.Die jungen Blätter sind ideal verwendbar für Salate (pur oder gemischt) und pikante Frühjahrskur-Mixgetränke. Die Blütenknospen lassen sich als Löwenzahnkapern, Mixed Pickles und Aufläufe zubereiten. Die Blüten selbst sind eine prima Grundlage für Gelee, Magenbitter, Liköre, Desserts und Dekoration, z.B. für Salate. Und auch die Wurzeln sind aufgrund ihres Fructosegehaltes eine Besonderheit: Löwenzahnkaffee, Wurzelkorn und eingelegte Wurzeln als Kurmittel.